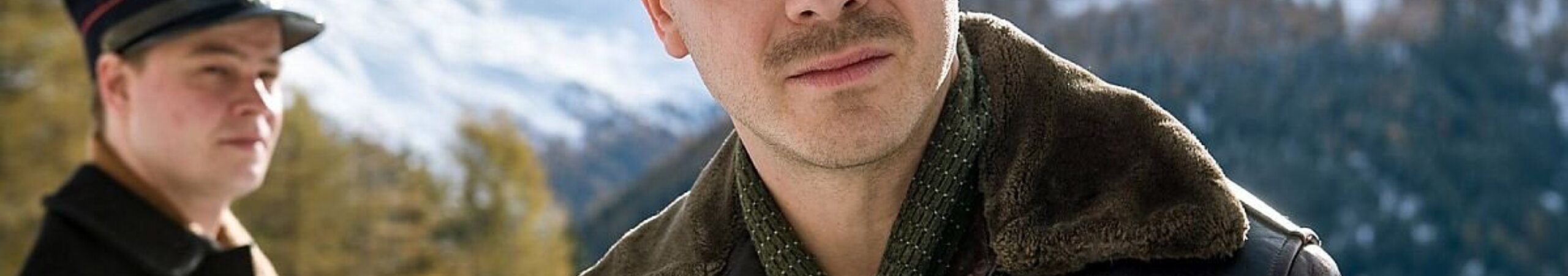
16.10.2025
Stiller
Regisseur Stefan Haupt, der schon mit Filmen wie jenem über die Sagrada Familia in Barcelona oder «Der Kreis», «Finsteres Glück» und «Zwingli» überzeugte, hat mit der Verfilmung von Max Frischs frühem Werk «Stiller» aus dem Jahr 1954 erneut ein Bijou vorgelegt. Die Vorlage ist trotz den für einen Film notwendigen Straffungen und gewissen Pointierungen klar erkennbar. «Wir haben uns entschieden, nahe am Buch zu bleiben, ohne ihm hörig zu sein», hat Stefan Haupt einmal als Grundhaltung umrissen. Die häufig gestellte Frage, wie genau eine Buchvorlage umgesetzt worden ist oder gar jene, ob das Buch oder Film «besser» sei, ist auch hier obsolet. Der Film spricht für sich und zieht die Zuschauenden 99 spannende Minuten in den Bann, ob man nun das Buch von Frisch kennt oder nicht.
Der US-Amerikaner James Larkin White wird in den 50er Jahren bei der Einreise in die Schweiz verhaftet. Ein Mitreisender glaubte, in ihm den gesuchten Bildhauer Anatol Stiller zu erkennen. Jener hatte sich im Spanischen Bürgerkrieg auf die Seite der Aufständischen gestellt, kam danach in der Schweiz in den Verdacht, ein kommunistischer Sympathisant zu sein und war seit ein paar Jahren verschollen. White beharrt darauf, er habe mit dem gesuchten Stiller nichts zu tun. Auch Stillers frühere Frau Julika, die die Behörden zu ihrer Unterstützung beziehen, bleibt vage. Einmal behauptet sie, mit dem vor ihr sitzenden Mann verheiratet zu sein. Ein anderes Mal ist sie unsicher, da sie an seinem Ohr eine ihr unbekannte Narbe ausmacht. Der Fortgang der Verwicklungen und das Ende des Films seien hier nicht verraten.
Gedreht wurde der Film in Zürich, einem Sanatorium in Davos, in München und weiteren bayrischen Ortschaften. Es ist faszinierend, wie markante Orte Zürichs in die 50er Jahre zurückversetzt und wie das Atelier und die Wohnung des jungen Stiller ein paar Jahre zuvor rekonstruiert wurden. Da stimmen alle Details, bis hin zum Knarren des holzigen Fussbodens in der Wohnung von Stiller und seiner damaligen Frau Julika.
Interessant ist, wie der Film ab und zu von Farbe in schwarz-weiss wechselt. Dies vor allem bei Rückblenden in die Zeit der Anwesenheit Anatol Stillers in Zürich. Wann welche Form gewählt wird, ist nicht immer plausibel. Ich glaube wahrzunehmen, dass vor allem bei jenen Sequenzen, in denen es um die Entfremdung und Eifersucht zwischen Stiller und seiner Frau Julika oder um einen Konflikt zwischen Stiller und seiner Geliebten Sibylle geht, auf schwarz-weiss zurückgegriffen wird. Wo in den Einstellungen zu den frühen Jahren Verliebtheit und Kreativität dominieren, ist Farbe angebracht. Spannend ist es dabei, wie die jeweiligen Beziehungen zwischen den Protagonist:innen und deren Entwicklung charakterisiert werden. Sei es zwischen Stiller und seiner Frau Julika, zwischen White (oder ist es Stiller?) und dem Gefängniswärter Knobel oder zwischen White/Stiller und dem Staatsanwalt Rolf Rehberg bzw. dem Pflichtverteidiger Dr. Bohnenblust.
Bei aller Dramatik der Geschichte, heitert der Film immer wieder auch mit witzigen Pointen auf. «Das wüsste ich doch» entgegnet White Stillers Frau Julika, als diese behauptet, sie seien verheiratet. «Die Schweizer sind nicht gemacht für den Krieg», wird geäussert im Zusammenhang mit dem glücklosen Einsatz Stillers im Spanischen Bürgerkrieg. «Wie kann ein Bildhauer sich nicht für Ballett interessieren», schleudert die Balletttänzerin Julika Stiller in der ersten Phase ihrer Verliebtheit entgegen. Oder der Gefängniswärter Knobel, der den gefangenen Stiller mit den Worten tröstet: «In der Schweiz hat sich noch immer alles aufgeklärt.»
Der Film lebt nicht zuletzt von der glücklichen Hand, die Haupt bzw. das Casting bei der Auswahl der Schauspieler:innen hatten. Zu den schweizerischen und deutschen Top-Darstellenden gehören Albrecht Schuch (James Larkin White), Sven Schelker (Anatol Stiller), Paula Beer (Julika), Max Simonischek (Staatsanwalt Rolf Rehberg) und Marie Leuenberger als dessen Frau Sibylle, Stefan Kurt (Pflichtverteidiger Bohnenblust) oder Marius Ahrendt (Gefängniswärter Knobel).
Wie soll jemand beweisen, dass er oder sie nicht derjenige/diejenige ist, für den oder die sie gehalten wird? Und: für wen halte ich mich selber? Habe ich das Recht, mich auch einmal neu zu erfinden und dies anderen zuzumuten? Der Film verweist in diesem Zusammenhang auch mal auf das sogenannte Bilderverbot in Exodus 20,4. Abgesehen von den Aspekten rund um Identität bzw. Fremd- und Selbstwahrnehmung geht es auch um die Frage nach «Wahrheit». «Helfen Sie Ihrem Mann, zur Wahrheit zu stehen», wird Julika einmal von Behördenseite ermahnt. Aber: Zu welcher Wahrheit? Was ist wahr? Als Zuschauende werden wir selbst ständig mit dieser Frage konfrontiert, etwa dann, wenn White den gutgläubigen Gefängniswärter mit einer abenteuerlichen Geschichte nach der anderen füttert. Welche Geschichte erzähle ich, wenn ich gefragt werde, wer ich sei? Der Film regt zu tiefgreifenden Diskussionen an und dokumentiert damit, dass Frischs Buch auch nach gut siebzig Jahren aktuell geblieben ist.
Hermann Kocher
Regie: Stefan Haupt
Schweiz/Deutschland 2025; 99 Min.
Besetzung: Albrecht Schuch, Sven Schelker, Paula Beer u.a. (s.o.)
Drehbuch: Alexander Buresch und Stefan Haupt
Kamera: Michael Hammon
Sprache: Deutsch
Im Kino ab 16. Oktober 2025

