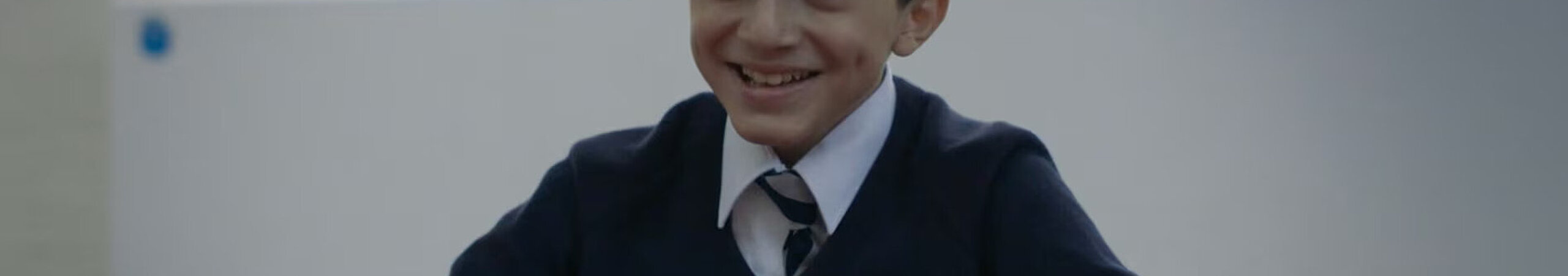
Human Rights Film Festival Zürich 2025
Ein Bericht von Hermann Kocher, Langnau i.E., Vizepräsident Interfilm Schweiz
Sascha Bleuler, Direktorin des «Human Rights Film Festival», und ihrem Team ist es erneut gelungen, einen Strauss von spannenden, herausfordernden und aufwühlenden Beiträgen zusammenzustellen. Das Zürcher Filmfestival findet unterdessen zum zehnten Mal statt (vom 27. März bis 2. April 2025). An Themen fehlt es ja in der gegenwärtig aufgewühlten weltweiten politischen Konstellation nicht!
Insgesamt 18 Filme stehen auf dem diesjährigen Programm, darunter drei herausragende Beiträge als Reprisen aus früheren Jahren. An dieser Stelle sollen vier Dokumentarfilme vorgestellt werden, mit denen sich die Jury von «Interfilm Schweiz» (Ivo Moser und Alisha Pfenninger) unter Moderation der Vorstandsmitglieder Peter Dietz, Hermann Kocher und Melanie Pollmeier anlässlich einer Tagung intensiv auseinandergesetzt hat.
Save our souls
In «Save our souls» (Jean-Baptiste Bonnet, Frankreich 2024, 91 Min.) hat der Regisseur während mehrerer Wochen Frauen und Männer auf dem Schiff «Ocean Viking» begleitet. Sie haben es sich zu ihrer Aufgabe gemacht, Geflüchtete zu retten, die versuchen, auf Booten von Afrika her das Mittelmeer in Richtung Europa zu überwinden.
Der Film kann als Porträt der selbstlosen Retter:innen geschaut werden oder als Dokumentation der Leiden der Geflüchteten. Letztere kommen zum ersten Mal nach 24 Minuten ins Blickfeld. Zuvor wird das Meer lange durch Feldstecher abgesucht, die Rettenden lernen Sätze in der Sprache Geflüchteter oder es muss der libyschen Küstenwache ausgewichen werden, die die «Ocean Viking» beschiesst. Über die Motivation der Rettenden erfahren wir wenig. Eindrücklich ist jedoch, wie sie den Geflüchteten nüchtern, ab und zu fast emotionslos begegnen. Dies mag eine Übertragung der Schockstarre sein, in der die jungen Menschen aus Afrika sich nach dem unsäglichen Leid auf der Flucht und in Libyen befinden. Vielleicht ist es aber auch gerade jene unaufgeregte Art, die den Geflüchteten die nötige Struktur und Sicherheit gibt, um die nächsten Schritte einzuleiten. Indem sie sich bedingungslos auf sie einlassen, geben die Aktivist:innen ihnen nichts weniger als ein Stück Menschlichkeit zurück. Und: Ohne die Bemühungen der Crew hätten jene die Überquerung des Mittelmeers in ihren notdürftigen Booten nie geschafft.
Dies dokumentiert der Film eindrücklich. Und er erinnert daran, dass jene Männer und Frauen eine Aufgabe wahrnehmen und so eine Lücke füllen, für die eigentlich die Politik bzw. die Regierungen der europäischen Länder zuständig wären. Spannend ist übrigens auch, obwohl es nicht ausdrücklich thematisiert wird, wie hier vermutlich verschiedene kulturelle Prägungen aufeinanderprallen: die jungen afrikanischen Männer (es handelt sich fast ausschliesslich um Männer) werden auf dem Schiff von einer allenfalls blonden Frau ohne Kopftuch mit klaren Anweisungen konfrontiert, wie sie sich zu verhalten haben. Vermutlich eine neue Erfahrung für etliche von ihnen ...
Immortals
Mit «Immortals» (Maja Tschumi, Schweiz/Irak 2024, 94 Min.) führt uns die Schweizer Regisseurin Maja Tschumi in den Irak von 2019. Vor allem junge Menschen haben sich in Bagdad und anderen Städten erhoben und gegen die Lebensbedingungen in dem durch die Invasion der USA und innere Konflikte gebeutelten Land protestiert. Maja Tschumi begleitet dabei stellvertretend zwei Jugendliche. In einem ersten Kapitel ist dies Melak Madhi (genannt Milo), die gegen gängige Rollenbilder rebelliert. Um sich draussen frei bewegen zu können, zieht sie Kleider ihres Bruders an und verhüllt ihr Gesicht. Eine Arbeitsstelle, für die sie sich beworben hat, wird ihr mit der Begründung verweigert, man suche eine hübsche Frau mit langen Haaren.
Der zweite Teil des Dokumentarfilms ist Mohammed Al Khalili gewidmet, der mit seinem Blick durch die Kamera sozusagen sich selbst und zu seiner Identität gefunden hat. Er dokumentiert die Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei im Jahr 2019 und bringt sich dabei selber in Lebensgefahr. Drei Jahre später hält er den Sturm des Parlamentsgebäudes in Bagdad fest. Die letzten Sequenzen sind nochmals sowohl Milo und Khalili gewidmet (die sich wider Erwarten nie direkt begegnen). Im Zentrum stehen hier ihre Zukunftsperspektiven, vor allem bei Milo die Fragen nach «Bleiben oder gehen?» Maja Tschumi verzichtet weitgehend darauf, Hintergrundinformationen zu den politisch-gesellschaftlichen Turbulenzen im Irak zu liefern. Dies kann auf der einen Seite als Mangel angesehen werden, hat aber andererseits den Vorteil, dass die Kamera sehr nahe auf die beiden Protagonist:innen fokussiert bleibt und der Film nicht einseitig belehrend auftritt.
Viele Szenen mussten nachgestellt werden. Dies wegen der zeitlichen Distanz zu den Ereignissen und als Schutz für alle am Projekt Beteiligten. Dass die Dialoge dabei ab und zu etwas hölzern wirken bzw. die Authentizität der Personen leidet, muss dabei in Kauf genommen werden. Eine der Stärken des Films liegt sicher darin, dass er uns Konflikte näherbringt, die für uns eher weit weggerückt sind. Besonders aufwühlend ist es zu sehen, wie neben staatlicher Repression die Strukturen der Familien bzw. Stämme verheerend wirken. So berichten Milo und ihre Freundin, wie sie zuhause eingesperrt werden, ihre Kleider vernichtet oder die Pässe eingeschlossen werden. Ein Beitrag, in dem viel von Ohnmacht die Rede ist, in dem aber auch dank des Engagements junger Menschen immer wieder Momente der Hoffnung aufblitzen. Dies wird mit ein Grund gewesen sein, dass «Immortals» anlässlich der Solothurner Filmtage 2025 mit dem «Prix de Soleure» ausgezeichnet worden ist.
State of silence
Der Dokumentarfilm «State of silence» (Santiago Maza Stern, Mexiko 2024, 80 Min.) führt uns nach Mexiko. Es handelt sich wohl um das schwierigste der hier vorgestellten vier Werke. Dies hängt nicht nur mit der verworrenen gesellschaftlich-politischen Lage im Land und der eher grossen Anzahl von Protagonist:innen zusammen, sondern auch damit, dass sehr viel und sehr rasch (spanisch) gesprochen wird und es anspruchsvoll ist, den englischen Untertiteln (und gleichzeitig den Bildern) zu folgen. Lohnen tut es sich auf jeden Fall, da wir Einblick bekommen in die (oft lebensbedrohlichen) Herausforderungen für Journalist:innen in jenem Land und in eine auch für uns zentrale Thematik: jene des Schutzes der Pressefreiheit. Regisseur Santiago Maza Stern begleitet vor allem vier Medienschaffende (Pino, Davish, Medina und Vizcarra), wobei die beiden Ersten ein Ehepaar sind. Die Journalist:innen dokumentieren die Not Geflüchteter an den Grenzen Mexikos zu Guatemala oder den USA, den Terror der Drogenkartelle, das illegale Abholzen von Wäldern oder die Enteignung von Bauern bezüglich des Zugangs zu den Wasserreserven sowie das Leid von Angehörigen von Menschen, die «verschwunden» sind. Dabei geraten sie zwischen die Fronten von kriminellen Kartellen und Regierungskreisen, die sie beide fürchten müssen. Aufwühlend sind jene Szenen, in denen sich die politischen Repräsentanten in ihren Erklärungen winden und vorgeben, die Arbeit von Journalist:innen schützen zu wollen, dies aber offensichtlich unterlassen.
Medienschaffende werden vielmehr bedroht, verfolgt, verschleppt, ins Exil getrieben oder ermordet. Im Abspann erfahren wir denn auch, dass in den letzten 24 Jahren in Mexiko 163 Journalist:innen getötet wurden und weitere 32 als vermisst gelten, ohne dass in praktisch allen Fällen ein Strafverfahren eingeleitet worden wäre. Wir lernen dabei den Begriff einer «Narcopolitica-Ordnung» kennen, was bedeutet, dass keine klar erkennbare Trennlinie zwischen Verbrechen und Staat (Regierung) besteht. Dadurch entsteht ein «State of silence», ein Zustand oder eine Region des Schweigens, wo gesprochen werden sollte (oder ist es der Staat, der jenes Schweigen fördert?). Der Film fordert dazu heraus, zu überlegen, wie es sein kann, dass Menschen, die solchen permanenten Bedrohungen ausgesetzt sind, ihren Idealismus, ihren Glauben an eine bessere Zukunft bewahren und ihren Weg unbeirrt weitergehen.
Er ist gleichzeitig ein Plädoyer für den Wert der Pressefreiheit, indem die Protagonist:innen immer neu betonen, wie wichtig für eine Gesellschaft der Zugang zu einer breiten Palette von Informationen und zur Unterscheidung von seriösen Nachrichten und «fakes» sind. Unsere Verhältnisse in der Schweiz sind keinesfalls zu vergleichen mit jenen in Mexiko. Entwicklungen in diversen Ländern und Veränderungen in der hiesigen Presselandschaft werden auch uns zu denken geben und uns motivieren, das Gut einer freien Presse zu verteidigen.
Name me Lavand
Im Gegensatz zu den drei vorherigen Filmen mit ihren stark gesellschaftlich-politischen Implikationen orientiert sich «Name me Lawand» (Edward Lovelace, England 2023, 91 Min.) eher an einem Einzelschicksal. Lawand ist gehörlos und deshalb im kurdischen Teil Iraks isoliert, ein Sonderling ohne Förderung. Zusammen mit seinem älteren Bruder Rawa träumt er davon, auf einem anderen Planeten zu leben, wo alle sind wie er, wo er sich nicht mehr als «besonders» und ausgeschlossen fühlen müsste. Da die Familie für ihren Sohn mit einer Behinderung keine Zukunft im Irak sieht, wagt sie sich auf eine entbehrungsreiche Flucht, die schlussendlich in einer englischen Kleinstadt endet. Durch Vermittlung eines anderen gehörlosen Mannes wird Lawand in eine Spezialschule für Gehörlose aufgenommen, in der er Gleichgesinnte findet und Freundschaften schliessen kann. Seine Weigerung, zu sprechen oder die traumatischen Erfahrungen in seinem Herkunftsort oder während der Flucht zu teilen, weicht langsam auf. Dies nicht zuletzt dank der sensiblen Begleitung durch eine Lehrerin, die selber gehörlos ist. Neben Lawands Bruder, der diesen fürsorglich unterstützt und durch dessen Brille wir öfters Einblick in Lawands Ergehen bekommen, öffnen sich – was besonders berührend ist - auch die Eltern. Sie, die früher Druck auf ihren Sohn ausgeübt haben, zu sprechen, lernen Brocken der Gebärdensprache. Lawand selber wird zum Fürsprecher seiner Familie, als dieser die Ausweisung aus England droht. Sein Gefühl, dazuzugehören, steigert sich nochmals, als er nach London fährt und zusammen mit anderen Gehörlosen die Anerkennung der Gehörlosensprache BSL (British Sign Language) fordert – mit Erfolg, wie im Abspann zu lesen ist.
Der Film dürfte auch ein breiteres Publikum in den Bann ziehen. Nicht nur wegen der Authentizität, mit der uns Lawand oder seine Lehrerin begegnen, sondern auch aufgrund einer bunten Palette an thematischen Zugängen: Umgang mit einer Behinderung, die Bedeutung von Sprache bzw. Kommunikation, die Frage nach Identität und Menschenwürde, das Finden des jeweiligen Platzes in der Gesellschaft oder traumatisierende Migrationserfahrungen, um einige mögliche Aspekte zu nennen. Regisseur Lovelace gliedert sein Werk in sieben Unterkapiteln mit entsprechenden Titeln. Dies scheint nicht zwingend, da der Plot an sich leicht nachvollziehbar ist. Herausragend ist demgegenüber die Tonspur: Gesprochenes und Töne nehmen wir oft sehr leise und gebrochen wahr, gleichsam versetzt in die Möglichkeiten Lawands. Der Film überrascht zudem mit drei verschiedenen Bildformaten: für die Rückblenden, die Erfahrungen in England und die Schlusssequenz (in der sich vielleicht etwas zu überraschend alles zum Guten wendet).
Preisträger
Die Interfilm-Jury hat entschieden, ihren Prix Célestine in der Höhe von Fr. 2'500.--an «Name me Lawand» bzw. Regisseur Edward Lovelace auszurichten. In der Laudatio hält sie fest:
«Der Film begleitet den tauben Jungen Lawand mit irakischer Fluchtgeschichte, der in England eine Schule für taube Kinder besuchen kann und dort erstmals kommunizieren lernt. Der Film berührt mit der Entwicklung des Jungen, der durch das Erlernen der Gebärdensprache sich selbst und seinen Platz in der Gesellschaft findet. Dabei kommen die Themen Andersheit und die damit verbundene Isolation bzw. Integration zur Sprache. Besonders überzeugt der Film durch die Leistung der Protagonist:Innen (Lehrerin und Lawand) und die Machart des Films (Ton und Flashbacks in Traumaerfahrungen). Lawand, der sich anfangs wie auf einem falschen Planeten gefühlt hat, findet am Schluss Heimat in mehrfacher Hinsicht.»

